

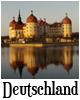

Jerusalem - Geburtsstadt des Glaubens
Auch wenn es nur einige Steine sind und die Gegend wüst und karg. Für gläubige Juden, Christen und Muslime ist die Stadtlandschaft Jerusalem ein einzigartiger Ort der Heiligkeit, um den sie immer wieder erbittert konkurrieren. "Das wirtschaftliche Leben Jerusalems konnte mit seiner religiösen und politischen Bedeutung nur selten mithalten. Die Last der Geschichte ist heute eine schwere Bürde." Die politischen Auseinandersetzungen, das Ziehen und Zerren zwischen Juden und Palästinensern, stehen zumeist im Mittelpunkt aktueller Nachrichten. Das Leben in der Stadt ist jedoch seit dem Bau der umstrittenen Mauer in der West Bank wesentlich ruhiger und friedlicher geworden. Das Fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist wieder Normalität geworden und trotz aller Streitereien kaufen Juden, Muslime und Touristen auf dem Mahane Yehuda Markt gemeinsam Jeans und Likör, Früchte, Fisch und Gewürze.
Im Bild der Felsendom und die Klagemauer, westliche Stützmauer des Herodianischen Tempels (rechts). Alle Zitate auf dieser Seite aus "Spiegel Geschichte", 2009).



Presselandschaft
Die meisten Zeitungen in Israel werden auf hebräisch herausgegeben, einige Zeitungen auch in arabischer Sprache. Die liberale Tageszeitung Haaretz (im Bild) wurde 1919 gegründet, gehört zur Haaretz-Gruppe und ist im Besitz der Familie Schocken. 2006 kaufte das Kölner Verlagshaus M. DuMont Schauberg, u.a. Besitzer der Mitteldeutschen Zeitung, 25 % des Aktienkapitals der Haaretz-Gruppe und damit auch an Haaretz.


Palästina, Judäa, Israel – Provinz, Königsstaat, Kolonie und gelobtes Land, heilig und ohne Frieden. Jerusalem – Sehnsucht, Wahn und nicht enden wollende Tragödie. Der ewige Konflikt am östlichen Rand des Mittelmeers ist einer der langanhaltendsten, emotionalsten und politischsten in der Geschichte. Jerusalem ist dabei politische Tragödie, „Verheißung und Erschrecken“ und zur Überdosis Gott stilisiert. Seit den zionistischen Gründerjahren Theodor Herzls ist der schmale Küstenstreifen zum nichtversiegenden Pulverfass des Nahen Ostens geworden.
Mehr als drei Milliarden Gläubige in allen Erdteilen schauen auf die Stadt in den Judäischen Bergen mit ihren 770.000 Einwohnern. „Weltliche Machtkämpfe und religiöse Inbrunst haben ihr Gesicht seit Jahrtausenden geprägt. Jerusalem ist durchdrungen von langer, multikultureller Tradition; geprägt von seinen Juden und Orthodoxen, den wenigen Christen, Armeniern und vielen Muslimen, den engen Vierteln, skurrilen Kleinkriegen und Nachbarschaftszwisten, die immer wieder für politischen Zündstoff sorgen. „Die langen Jahre des friedlichen Miteinanders stehen im Schatten immer wieder aufflammender Konflikte.“
Kreuze in Silber und Holz für einige Shekel, Rosenkränze und Jesusbilder in Dutzenden Körbchen. In den Auslagen der Geschäfte liegen Davidsterne und Kruzifixe friedlich nebeneinander; Koranausgaben neben Kipas und Menora-Leuchtern. Der Kreuzweg des Jesus von Nazareth entlang der Via Dolorosa ist, wenn auch historisch nicht verbürgt, so doch eng bestückt von Souvenirläden, Cafehäusern und „Rent-A-Cross“ Geschäften. Millionen Gläubige pilgern jedes Jahr nach Jerusalem, Christen, Juden und Muslime. Trotz anhaltender Zwischenfälle, wie dem Blutbad im Mai 2010, bei dem die israelische Marine in internationalen Gewässern sechs mit Hilfsgütern beladene Schiffe enterte und neun Aktivisten auf dem Schiff Mavi Marmara tötete, wurden für 2010 etwa 3,45 Millionen Besucher in Israel verzeichnet. Ein historischer Höchststand seit der Gründung des Staates Israel im Mai 1948, wie das Tourismusministerium vermeldete. Es sind die Wallfahrer, die dorthin gehen, wo Jesus lebte, die den Gott des Judentums spüren wollen, die Nähe des Propheten oder auch nur sich selbst. Es sind Menschen, die ihre Verwandten und Freunde besuchen oder einfach nur Urlaub machen an historischen Stätten. Israel ist nichts für Fastfood-Touristen; nicht zu vergleichen mit Mallorca und der Türkei. In Israel und besonders in Jerusalem gilt: erst pilgern, dann besuchen.
Mit gesundem Abstand vom Pilgerwahn lassen sich all die Amerikaner, Armenier, Äthiopier, Katholiken und Juden, Deutschen und Koreaner objektiv und humorvoll analysieren. „Spiegel Geschichte“ berichtete 2009 über die griechisch-orthodoxen Pilger und christlichen Wallfahrer am Karfreitag auf dem – historisch inzwischen nicht mehr verbürgten – Kreuzweg des Jesus von Nazareth. Während die einundsiebzigjährige Frau Holl „viermal das Vaterunser gesprochen, neun Lieder gesungen und eine Messe gefeiert hat, ... in acht Kirchen und Kapellen gebetet sowie eine Portion Falafel und einen Wiener Apfelstrudel verspeist“ hat, erwarb „Misses Christyn Enenche, 41, Unternehmerin aus Abuja, Nigeria ... ein Dutzend Schlüsselanhänger, Kugelschreiber und Holzkreuze“. Jerusalem ist die „Geburtsstadt des Glaubens“, titulierte der „Spiegel“. Einmal Felsendom, Grabeskirche und Kreuzweg zum Anfassen. Entlang der Via Dolorosa drängen sich Deutsche und Koreaner, Russen, Bayern und Muslime von Station zu Station. Händler prallen auf orthodoxe Juden, Türken, Kopten und Frau Holl. So heilig die Stadt, so sehr sind die Besucher gewarnt, auf ihre Taschen und Geldbörsen aufzupassen. Der Leidensweg von Jesus ist zum Umschlagplatz für Kruzifixe, „rosa Spitzen-BHs, chinesisches Plastikspielzeug und T-Shirts mit „Israel Army“-Aufdruck“ geworden. Eine geführte Reise bietet „eine Mischung aus Religion, Entertainment, Klassenfahrt und Einbürgerungskurs. Sie zeigen den Amerikanern, wie man Sesamkringel mit Saatar-Gewürz isst, sie bringen ihnen bei, dass „danke“ hebräisch „toda“ heißt, und zwischendurch kommt immer mal wieder die Rede auf König David. Nur Gabi, der Junge mit der Uzi, der für die Sicherheit da ist, erinnert an die Probleme des Landes.“
Wir trafen auf Kurt, einem sympathischen Priesteranwärter aus Niedersachsen, der in die heilige Stadt kam auf der Suche nach dem Glauben, nach Belegen und Antworten; seine jüdische Liebe fand, konvertierte und seit einigen Jahren im jüdischen Viertel lebt. Individualreisende entgehen meistens der vielversprechenden Gruppendynamik, doch den verklärten Blicken und dem Feilschen, Drängeln und bunten Menschenwirrwarr kann sich niemand entziehen. Es ist gerade dieses Sprachengewirr zwischen Löwentor und Erlöserkirche, es sind die Spannungen zwischen Damaskustor und Klagemauer, die faszinieren und polarisieren und immer wieder den Blick auf die Stadt lenken, um die seit Jahrhunderten drei große Weltreligionen feilschen und konkurrieren.
Eintausend Jahre vor Christi Geburt wurde Jerusalem zum Sitz der israelitischen Könige und schließlich zum wichtigsten Ort des Judentums. Die Überlieferungen und noch heute praktizierten Glaubensbekenntnisse zeugen von einer besonderen Beziehung eines Volkes zu seiner Stadt. Bräuche halten die Erinnerung seit tausenden Jahren wach; keine jüdische Hochzeit findet statt, ohne dass der Bräutigam ein Glas zertritt, um an die Zerstörung des Tempels im Jahr 66 durch römische Legionäre unter Titus zu erinnern. „Wenn ich dich vergesse, oh Jerusalem, soll meine rechte Hand verdorren. Meine Zunge soll an meinem Gaumen haften bleiben, wenn ich dich Jerusalem nicht als meine höchste Freude betrachte.“, zitiert der Bräutigam gleich dem Eheschwur. Die große jüdische Liebe wird zur Urmetropole der Christenheit und suchen Pilger seit dem Jahr 326 nach den Spuren des Gekreuzigten. Als eine der Ersten pilgert die 70-jährige Helena, fromme Mutter Kaiser Konstantins, nach Palästina, um vor Ort zu erkunden, wo Jesus gelitten, gestorben und auferstanden ist. Ihre Wallfahrt ist der Beginn eines Pilgerstroms, der seither nie mehr angerissen ist. Doch nach dem Juden- und Christentum entdeckt die neuentstandene Religion des Islam Jerusalem als Heilige Stadt. Bald nach dem Tod des Propheten Mohammeds 632 in Medina, wurde Jerusalem unter die drei einzig zugelassenen Pilgerziele aufgenommen.
Und so bleiben die Spuren der Vergangenheit die Wege der Gegenwart. Geschichte steckt unter jedem Stein, unter jeder Straße, jedem Abwasserkanal. Konservative Israelis vertreiben palästinensische Familien aus ihren Wohnungen, um sich durch frühjüdische Tunnel und Tempel zu graben. „Denn die Zeit vergeht nicht in Jerusalem, nicht so wie in anderen Orten.“, schreibt Clemens Höges. „Alles ist Gegenwart. Was vor Jahrtausenden passierte genauso wie das, was vor Jahrzehnten geschah. Nichts wird vergeben, schon gar nicht vergessen. Die Menschen von heute verstricken sich heillos in den Kämpfen ihrer Vorfahren.“
Nach den endgültig letzten Kreuzzügen des Mittelalters wuchs das Interesse am Heiligen Land zu Beginn des 19. Jahrhunderts sprunghaft. „Erwartungsvoll strömten Wissenschaftler, Pilger, Missionare, Literaten und Majestäten zu den Sehnsuchtszielen.“ Mark Twain, Hermann Melville, Nikolai Gogol und der preußische Kronprinz Friedrich Wilhelm schlossen sich dem wachsenden Touristenströmen an. Gustave Flaubert beschreibt seine Treffen zynisch: „Wir ziehen durch das Jaffa-Tor ein, ich lasse beim Betreten seiner Schwelle einen Furz los, ganz unwillkürlich; im Grunde war ich sogar ärgerlich über diesen Voltairianismus meines Anus ... Mitten auf der Straße vor unserem Hotel verwest unbeachtet ein gelber Hund, ohne das jemand daran denkt, ihn woanders hinzustoßen ... Überall Ruinen, es riecht förmlich nach Grab und Verwesung; Gottes Fluch scheint über der Stadt zu liegen, der Heiligen Stadt von drei Religionen, die vor Langeweile, Entkräftung und Verlassenheit dahinstirbt.“ Fünfzig Jahre später lockten Reiseunternehmen wie die des Thomas Cook die Touristen mit Klima und Exotik nach Palästina.
Seit dem Bau der umstrittenen Mauer durch das Westjordanland ist es immerhin friedlicher geworden in Jerusalem. Das Risiko, beim Fahren in öffentlichen Verkehrsmitteln Opfer eines Bombenattentats zu werden, ist wesentlich geringer geworden. Nur die notorisch unsicheren Gebiete in der Nähe des Gaza-Streifens sollten tunlichst vermieden werden. Diese sind den Palästinensern vorbehalten, deren Elend seit der israelischen Operation "Gegossenes Blei" im Dezember 2008 nicht nur in zivilen Opfern zu zählen, sondern auch dem nachfolgenden israelischen Boykott zuzurechnen ist. Doch ein Ende der Gewaltspirale ist nicht in Sicht. Mehr denn je verlaufen die Fronten inzwischen nicht nur zwischen Arabern und Juden sondern kreuz und quer durch die israelische Gesellschaft und sorgen für beständigen Zündstoff zwischen ultraorthodoxen und liberalen Juden, orthodoxen Zionisten und Militärs, die der Arbeiterpartei nahe stehen.
Palästinenser und Israelis bedingen sich heute gegenseitig; Christen sind zur Minderheit im Land ihres Ursprungs geschrumpft. Doch in der Grabeskirche, dem heiligsten Ort der Christenheit in Jerusalem, bekämpfen sich die Geistlichen der verschiedenen Konfessionen unversöhnlich. Hier leben Armenier, Syrer, orthodoxe Griechen, Äthiopier, Kopten und katholische Franziskaner unter einem Dach. Eine gottesfürchtige Wohngemeinschaft mit eigener Uhrzeit, drei Kalendern, etwa fünfzig Bewohnern aus einem Dutzend Ländern und unendlichen Streitigkeiten. Die „Spiegel Geschichte“-Reporterin Juliane von Mittelstaedt lernte den sensiblen Alltag kennen, der dort herrscht, wo der Leichnam Jesu gelegen haben soll. „Wenn sich fünf Familien eine Küche teilen – da gäbe es doch auch ständig Streit“, sagt Bruder Fergus, mit Nachnamen Clark, ein Ire, weiße Haare, stahlgraue Augen, kantiges Gesicht. Der Präses der Franziskaner ist außer Atem. In der Kapelle feiern Mexikaner Messe, im Nebenraum Nigerianer, davor wartet schon die nächste Gruppe. Bis zu drei Messen gleichzeitig, bis zu 27 am Tag, dazu das tägliche Hochamt am Heiligen Grab, Stundengebete und die lateinische Messe ab halb fünf Uhr morgens – der Präses hat einen Terminkalender wie ein Manager. Fünf Wochen Kirche, eine Woche frei, ein Leben, aufgeteilt nach einem strengen Schichtplan, mit Beichtbereitschaft und Wachdienst am Heiligen Grab. „Die Alltagsroutine funktioniert gut, da weiß jeder, was zu tun ist, und meistens bleibt alles friedlich“, sagt Bruder Fergus. „Aber wehe, die Feiertage der unterschiedlichen Konfessionen fallen zusammen.“ Eine winzige Änderung reicht, um die fein justierte, seit Jahrhunderten eingespielte Maschinerie der Grabeskirch aus dem Takt zu bringen. Da genügt es, dass im falschen Moment eine Tür offensteht, ein Stuhl in den Schatten gerückt wird oder sich ein Priester zur falschen Zeit am falschen Ort befindet. Dann geraten Franziskaner mit Griechen aneinander, Kopten mit Äthiopiern, Griechen mit Armeniern. Und im Handgemenge verliert einer der israelischen Polizisten, die vor der Kirche wachen, auch mal einen Zahn. Die im Jahr 326 erbaute Grabeskirche ist der einzige Ort im Heiligen Land, an dem sich die Christen streiten, und Juden und Muslime vermitteln.“

Vorbereitung zum Sukkot
Das jüdische Laubhüttenfest ist eines der drei Wallfahrtsfeste. Das Fest hat sich über die Jahrhunderte stark verändert. Im 5. Buch Mose wird das Fest beschrieben: „Wenn nicht nur die Getreide-, sondern auch die Weinernte eingebracht ist, sollt ihr sieben Tage lang das Laubhüttenfest feiern. Begeht es als Freudenfest mit euren Söhnen und Töchtern, euren Sklaven und Sklavinnen und mit den Leviten in eurer Stadt, den Fremden, die bei euch leben, den Waisen und Witwen.“

Jüdischer Friedhof
Die Altstadt von Jerusalem wurde 1981 von der UNESCO zum Weltkulturerbe der Menschheit erklärt. Seit dem Mittelalter ist sie in das armenische Viertel, das christliche, jüdische und muslimische im Nordosten unterteilt und von einer aus dem 16. Jahrhundert stammenden, fast vollständig erhaltenen Stadtmauer umgeben.

Panzer auf den Golanhöhen
Seit dem Sechstagekrieg 1967 werden die dünn besiedelten Golanhöhen von Israel besetzt. Durch den anhaltenden Status dieses Landstriches werden die Friedensverhandlungen zwischen Syrien und Israel seit Jahrzehnten behindert.

Masada
„Ein ruhmvoller Tod ist besser als ein Leben im Elend.“ Die ehemalige jüdische Festung ging durch ihre Belagerung im Jahr 73 n. Chr. durch die Römer und den Massensuizid der belagerte Juden in die Geschichte ein.

Totes Meer
Durch die ständige Wasserentnahme aus dem Jordan zur Versorgung Israels und Jordaniens mit Trinkwasser ist das Salzmeer seit Jahren von schleichender Austrocknung bedroht.