

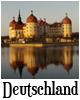

Klösterle an der Eger
Die Stadt, heute Klásterec nad Ohrí, wurde erstmals 1352 schriflich erwähnt. Nach dem Ende des sächsischen Bruderkrieges erwarb Apel Vitzthum der Ältere zu Roßla, nachdem er 1452 der wettinischen Lande verwiesen und in Böhmen 1453 als Rat des dortigen Königs eine neue Anstellung fand, neben der Herrschaft über die nahe Schönburg, auch die über den Flecken an der Eger.
1621 kaufte die Familie Thun und Hohenstein das Schloss Klösterle und ließ die Barockkirche "Der allerheiligsten Dreifaltigkeit" erbauen. Nach der Gründung der ersten Porzellanmanufaktur 1794 gewann der Ort an Bedeutung und wurde in der ganzen Region bekannt.
Nach 1945 wurde wie im gesamten Sudetenland die deutschböhmische Bevölkerung enteignet und aus ihrer Heimat vertrieben.



Presselandschaft
Das "Nachrichtenblatt für die heimatvertriebenen Landsleute aus dem Kreis Kaaden-Duppau" wurde wie viele ähnliche Publikationen über Jahrzehnte zum letzten Informationsblatt der verlorenen Heimat.


Viele Jahre erinnerte „dr Nochbor Seff“ an die verlorene Heimat, hielt den Dialekt seiner Kindheit und der Ahnen aufrecht. Jahrelang schrieb er im Kaadner Heimatbrief gegen die Zeit, das Vergessen und gegen den Hass. Josef Jugl gehörte wie weitere drei Millionen Sudetendeutsche zu den Leidtragenden des Zweiten Weltkrieges.
Für mich war der Heimatbrief, den meine Großmutter erst nach der politischen Wende 1989 beziehen konnte, eine Broschüre vergangener Zeiten, gefüllt mit Geburtstagslisten alter Menschen und Todesanzeigen. Obwohl ich wußte, wo meine Wurzeln lagen, war es mir nicht gelungen, Kontakt zu den Enkeln meiner deutsch-böhmischen Nachbarn zu finden.
Ich hatte noch nicht das Erwachsenenalter erreicht und doch waren Menschen und Landschaft zwischen Karlsbad und Komotau, dem heutigen Chomutov, vertraut; ich liebte die Vulkanlandschaft, den weiten Bogen des Egerflusses, Oblaten, Meerretichsenf und Franzbranntwein. Von den tiefsitzenden Ereignissen, die über Jahrzehnte das Verhältnis zwischen Deutschen und Tschechen belasteten, war ich, wie viele meiner Generation, befreit. Meine Heimat lag tatsächlich an der Unstrut, meine Wurzeln ebenso irgendwie im böhmischen Erzgebirge wie im Wartegau und das Missverhältnis in Churchills Streichhölzern. 1984 wunderte ich mich darüber, dass wir uns mit Frau Lux in Horni Halze (Oberhals) in Deutsch unterhielten und ihre Tochter in der nahen Kapelle deutsche Lieder sang. Als gelernter DDR-Bürger verband ich unsere Fahrten ins Egerland mit Abenteuer und anderen Kulturen.
„Mir homm uns jo scho oft driewer unterholtn, woß der Begriff „Heimat“ olles umschließt. Fier monche Leit is Heimat in erster Linie de Londschoft, es Elternhaus, der Friedhuf un vielleicht nuch de Kerch un de Schull. Sie nekn nett dro, daß erst de Heimatleit de Londschoft zur Heimat mochn. Weil des sui s, frei mer uns aa, wemmer moll jemond aus der oltn Heimat treffn. Freilich, wu de Heimatleit su eng aff enonner hockn, wie des teilweis in Bayern der Foll is, do mooch des nix besunders sei, oower bei uns in Niedersochsn, wus gonz wenich Sudetndeitsche gitt, do iss u e Zommtreffn scho e Ereignis. Doo koos dann possiern, daß mer inneren Geschäft, am Bohnhuf oder sunst wu, jemond redn hört un plötzlich spitzn mir de Ohrn! Wor do nett e Klong, der uns bekonnt vorkimmt? Der di redt mooch ruhich hochdeitsch redn, irgend woß leßt uns aufhorchn. E besunders Wort, e Redewending, e Ton hott fier uns suwoß wie ne Signalwirkung.“, schrieb Jugl Seff 1990.
Ich war in den späten 1990er Jahren, nach Wende und kommunistischer Implosion, arbeitsbedingt gezwungen, eine zweite Heimat zu suchen. Der Osten Deutschlands konnte mir keine Arbeit bieten und ich fand diese und Freunde in Niedersachsen. Im Laufe der Jahre konnte ich jedoch die Not meiner Altvorderen besser verstehen, ohne allerdings direkt an ihre und somit meine Wurzeln heranzukommen. Da ich mir derer bewußt werden wollte, begab ich mich im Frühjahr 2011 auf eine Zeitreise und traf in Klösterle auf die letzten Deutschböhmen.
Seit nun mehr als sechs Jahrzehnten heißt Klösterle Klásterec nad Ohrí, ebenso wie aus Gottesgab Bozí Dar wurde und in die ehemals deutschen Siedlungsgebiete nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges Zigeuner, Slowaken und Tschechen zogen. Es ist eines der langen und traurigen Episoden in der europäischen Geschichte, deren Wahrheiten erst seit den Jahren der politischen Wende verstärkt beleuchtet und besprochen werden. Doch die Vertreibung der Deutschen aus ihrer Heimat nach dem Krieg polarisiert noch heute, drei Generationen nach den Ereignissen von 1945/47. Der Todesmarsch von Brünn, die Massaker von Podersam/Podbodany, Postelberg/Postoloprty und Saaz/Zatec hinterließen ihre Spuren und mussten doch bis 1989 für die Überlebenden Tabu bleiben.. Familien verstreuten sich über Deutschland, nach Sachsen, Bayern, Niedersachsen. „Ihr wolltet doch heim ins Reich“ hieß es für Frauen und Kinder, deren Männer, Väter und Söhne den Krieg überstanden hatten oder, erst wieder in der Heimat angekommen, geradewegs in Kriegsgefangenschaft gingen. Lehrer, Obsthändler, Ingenieure, Schriftsetzer und Dachdecker, Hebammen und Lehrer mussten ihre Heimat verlassen. Bauern, die über Generationen, oft mehr als 300 Jahre lang, ihr Land bewirtschaftet hatten, wurden erst in den „wilden Vertreibungen“, später in Massentransporten von ihren Höfen, Häusern oder aus ihren Wohnungen vertrieben. Hab und Gut mussten zurückbleiben, ein Koffer und 30 Kilogramm für die Familie reichen.
Einmal im Jahr treffen sich heute die letzten Sudetendeutschen zum Frühlingsfest. Früher fanden die Treffen öfter statt, 1991 zum ersten Mal auch offiziell in der alten Heimat. Doch Krankheit, Alter und dem Dahinscheiden der alten Landsleute geschuldet, schmilzt auch der Haufen der letzten Deutschböhmen immer mehr. Wo sind die Nachfahren, die Kinder und Enkel der Vertriebenen, wo haben sie ihre Heimat gefunden, neu definiert und aufgebaut? Interessieren sie sich nicht neben I-Phone, Internet und Globalisierung für ihre Wurzeln; für die Heimat ihrer Eltern und Großeltern? Ist die Vergangenheit so unwichtig und nur mit alten Trachten und Volksweisen zu berbinden? Rechte Stimmung kam selbst während des Treffens nur gelegentlich und so richtig erst am letzten Abend auf. Die Organisation des Klösterlischen Treffens hinkte ein wenig hinterher und sorgte für zerknirschte Laune. Früher sorgten Mila Kral mit seiner Teufelsgeige und Fischer Annie für Stimmung. Doch Rock’n’Roll und Hip-Hop sind an den Sudetendeutschen vorbeigegangen und heute wirken die Lieder von Anton Günther trotz ihrer Aktualität antiquiert. Anton Günther, der wohl bekannteste Volksdichter des Erzgebirges gilt heute als Ikone. Seine Lieder hielten Mundart und Lebensstimmung der Einheimischen fest. Günther, der sich 1937 das Leben nahm, stand fest zu seiner deutsch-böhmischen Heimat, ohne sich, wie viele seiner Generation, von den Nationalsozialisten vereinnahmen zu lassen. Doch auch andere ließen sich nicht vereinnahmen; kamen nur oft zum falschen Zeitpunkt an den falschen Ort.
Den letzten Sudetendeutschen geht es nicht um Vergeltung, sondern um Gerechtigkeit. Sie glichen mir den Indianern Nordamerikas, die in Reservationen und von der Sozialhilfe der Weißen leben. Immerhin gelten die Sudentendeutschen in Bayern als vierter Stamm. Die Zeit spielt gegen die, die an der Heimat hängen und als Kinder oder Jugendliche von ihren Wurzeln abgerissen wurden. Die Politik und mächtige Männer entschieden, dass drei Millionen Menschen ihre Heimat aufgeben mussten, ihre Pferde, Hunde und Kühe, ihre Wurzeln und Traditionen. Churchills Streichhölzer und die verlorene Heimat waren schon längst von den deutschen Politikern akzeptiert worden. „Wie sieht es aus daheim?“, stellten sich die Entwurzelten immer wieder die Frage. Oft war es ihnen erst zwanzig Jahre später mit einem Visum möglich, in die Heimat zu fahren, einen Blick auf Haus und Hof zu werfen, auf die alten Apfelbäume und Kirschplantagen, die sie selbst noch vor Ausbruch des Krieges angelegt hatten.
„No, wenn miech nett olles teischt, sei Sie aa kaa Hiesicher!“ Der su Oogesprochene is ert e bißl perplex, weil er sich aff sann akzentfreie Hochdeitsch nett grood wenich eibildn tutt, gitt ower dann doch zu, daß der Froocher richtig vermutet hott, vermeidet oower nähere Oogohm zu mochn, weil ne der Froocher jo nett bekonnt is. Letzterer will oower der Soch genau affn Grund geh und froocht noch seiner Herkunft. De Ontwort lautet: „Iech bie e Sudetndeitscher.“ Oower aa mit dere Auskunft gitt sich der Froocher nett zufriedn un will wissen vo wu im Sudetenlond? De Ontwort: „No, holt ausn Eecherlond!“ Der Froocher widder: Woß, ausn Eecherlond, no vo wudn do?” “Aus de Korlsbooder Gegnd” soocht der onnere. “No, wo denn do genau?” bohrt der Froocher weiter. „Holt ausn Kreis Koodn, wenn Ihnen des e Begriff is! Ower nun verrotn se mir doch endlich molln Ihrn Geburtsort?“ „No, wenn iech ihne denn aa sooch, denn kenne se gonz bestimmt nett, denn des is jo neer e klaans Nest, oower wenn se es genau wissen wolln, iech bie von Klesterle.“ Dodrauf der Froocher: „ No, du Sperrgusch du olwere, worum sochstn des nett gleich, iech bie nemlich von Koodn un ho in der SUMAG gerwet.“ Do is pletzlich es Eis gebrochen und scho geht de gegnseitiche Froocherei los: „Kennst du denn un kennst du denn? Waßt du nuch? Un woß holt in solchn Fälln olles gfroocht wird.De „Sperrgusch“ wird nett weiter iewl gnumme, weil des jo sozusoogn e Koodner „Marknzeichn“ is. De „Sperrgusch“ iss u weit vo ner Beleidigung entfernt, wie z.B. e freindschoftlicher Rippnstoß vo ren Boxhieb. Wer des nett weiß, der is scho monchmoll bißl schockiert, wenner vo en Koodner su tituliert wird. Oower des koo ner jemond sei, der vo de Koodner kaa Ohning hott. De „Sperrgusch“ hott sich natierlich inzwischn aa es Umlond vo Koodn erobert, su daß mer denn Ausdruck im gonzn Koodner Kreis hörn koo. Es hott sich oower bisher nuch kaa Koodner wegn des Diebstohls geistichn Eigentums beschwert, su daß aa mir gutn Gewissns uns der „Sperrgusch“ bediene kenne. Wenn zu mir jemond „Sperrgusch“ soocht, do fonge mir direkt de Augn oo zu leichtn, weil aa dieser Ausdruck e Stickl Heimat is.“

Egerland bei Klösterle
Südlich des Erzgebirgskammes erstreckt sich das Duppauer Gebirge, das nach 1945 zur militärischen Sperrzone wurde. In über 40 Jahren wurden die Ortschaften der vertriebenen deutschen Bevölkerung für Kriegsmanöver zweckentfremdet. Heute existiert keine Ortschaft mehr.

Kolonnaden Karlsbad
Die alte Kurstadt zog unter anderen bereits die Herren Goethe, Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Brahms und Michael Douglas, Morgan Freeman, Leibniz und Karl Marx mit seinen Kureinrichtungen und Heilquellen magisch an.

Obladen handgemacht
Karlsbader Obladen, mit Schokolade oder Vanillie gefüllt, waren schon immer der Verkaufsschlager. Frisch und handgefertigt werden sie noch heute angeboten.

Karlsbad Hotel Pub
Das 1701 gegründete, am Ufer der Teplá gelegene Grandhotel, war schon immer ein Besuchermagnet, für Übernachtungen und einen Kaffee die erste Adresse.

Kaaden an der Eger
Vermutlich im 11.Jahrhundert gegründet, war die Stadt bis zum ersten Weltkrieg Garnison der K.u.K. Österreichisch-Ungarischen Armee. Am 4. März 1919 demonstrierten die Kaadener Deutschböhmen für das Selbstbestimmungsrecht und den Verbleib bei Österreich. Bei der Auseinandersetzung mit dem in der Stadt stationierten tschechischen Militär wurden 17 Personen getötet, 30 schwer und 80 leicht verwundet.